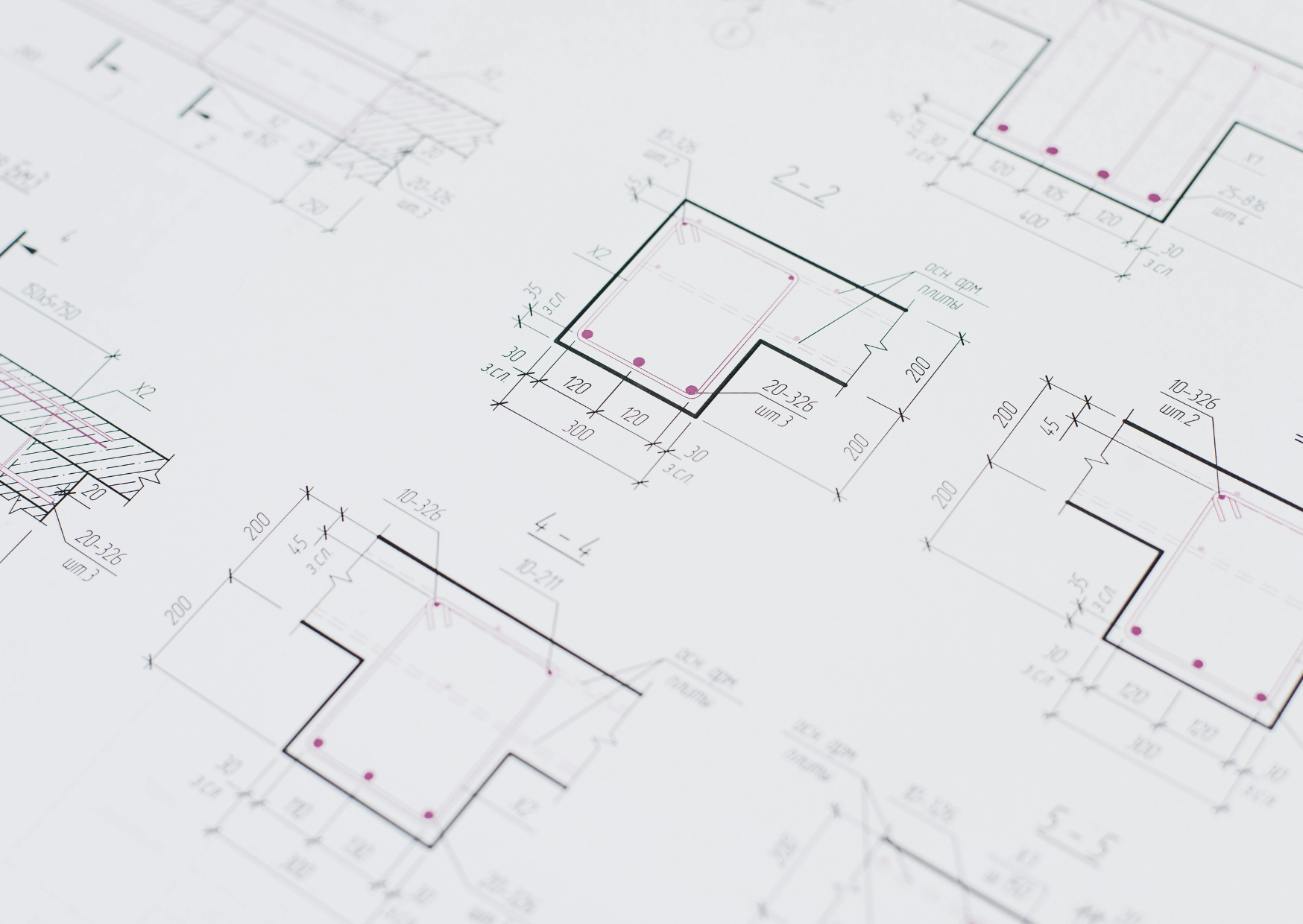Das Stockwerkeigentum ist in der Schweiz eine der verbreitetsten Formen des Wohnungseigentums. Mit dem Stockwerkeigentum ist Wohneigentum möglich, ohne dass dabei ein ganzes Haus erworben werden muss.
Juristisch gesehen ist das Stockwerkeigentum eine qualifizierte Form des Miteigentums, was diverse Fragen aufwirft: Was gehört mir allein? Welche Teile sind gemeinschaftlich? Wer hat was zu entscheiden? Wie wird das Stockwerkeigentum überhaupt begründet? Und wie wird eine Stockwerkeigentumseinheit gekauft und verkauft?
1. Was ist Stockwerkeigentum?
Das Stockwerkeigentum ist in den Art. 712a ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) geregelt. Das Gesetz definiert das Stockwerkeigentum als «Miteigentumsanteil an einem Grundstück, der dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen» (Art. 712a Abs. 1 ZGB). Ein Stockwerkeigentümer hat also einen Miteigentumsanteil am gesamten Grundstück, sowie ein ausschliessliches Sonderrecht an bestimmten Räumen.
Sonderrechtsfähig sind abschliessbare und wirtschaftlich Einheiten. Das heisst, dass man nur an gewissen Teilen eines Grundstücks resp. eines Hauses ein Sonderrecht haben kann, wie z.B. an einer Wohnung oder an einem abschliessbaren Hobbyraum.
Nicht sonderrechtsfähig, und damit in gemeinschaftlichem Eigentum ohne Exklusivitätsrecht eines Stockwerkeigentümers sind insb.:
- der Boden der Liegenschaft;
- Bauteile, die für den Bestand, die konstruktive Gliederung und Festigkeit des Gebäudes oder der Räume anderer Stockwerkeigentümer sind (wie z.B. das Dach oder das Fundament);
- Bauteile, die die äussere Gestalt und das Aussehen des Gebäudes bestimmen (wie z.B. die Fassade);
- Anlagen und Einrichtungen, die auch den anderen Stockwerkeigentümern für die Benutzung ihrer Räume dienen (wie z.B. das Treppenhaus)
Beispiel:
Frau X ist Eigentümerin von 120/1000 Miteigentumsanteile an einer Liegenschaft. Zu ihrem Anteil gehört das Sonderrecht an einer 3½-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss. Sie darf diese Wohnung ausschliesslich bewohnen oder vermieten. Über das Treppenhaus und die Fassade hat sie aber keine selbständige Verfügungsmacht, weshalb sie diese nicht ohne Weiteres streichen oder sonst wie verändern darf.
2. Organisation der Stockwerkeigentümergemeinschaft
Wie gesehen, sind Stockwerkeigentümer gemeinschaftlich an einem Grundstück berechtigt, wobei sie in Bezug auf gewisse Teile ein Sonderrecht verfügen. Da es sich um eine Form des Miteigentums handelt, kann ein Stockwerkeigentümer nicht völlig frei über das Grundstück resp. das darauf stehende Haus verfügen. Er ist Teil der sog. Stockwerkeigentümergemeinschaft.
Die Stockwerkeigentümergemeinschaft ist wie folgt organisiert:
Stockwerkeigentümerversammlung: Im Rahmen der Stockwerkeigentümerversammlung treffen sich die Stockwerkeigentümer eines Grundstücks und entscheiden über die Angelegenheiten, über welche sie gemeinsam zu beschliessen haben. Die Stockwerkeigentümerversammlung kann weitere Regelungen in einem Stockwerkeigentümerreglement aufstellen. Ebenso kann dieses Gremium darüber entscheiden, ob sie für die Stockwerkeigentümergemeinschaft einen Verwalter einsetzen wollen.
Für die Beschliessung baulicher Massnahmen an den gemeinschaftlichen Teilen sind gewisse Quoren einzuhalten:
- Notwendige bauliche Massnahmen: Sind die baulichen Massnahmen notwendig für die Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit des Grundstücks resp. des Hauses, so können diese beschlossen werden, wenn die Mehrheit der Stockwerkeigentümer zustimmt;
- Nützliche bauliche Massnahmen: Dienen die zu beschliessenden baulichen Massnahmen der Wertsteigerung oder der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit des Grundstücks resp. des Hauses, so muss die Mehrheit der Stockwerkeigentümer zustimmen, die gleichzeitig zusammen mehr als 50% der Quote des Grundstückes vertritt.
- «Luxuriöse» bauliche Massnahmen: Bauarbeiten, die lediglich der Verschönerung, der Ansehnlichkeit oder der Bequemlichkeit im Gebrauch dienen, dürfen grundsätzlich nur mit der Zustimmung aller Stockwerkeigentümer beschlossen werden. Eine Mehrheit der Eigentümer, die gleichzeitig zusammen mehr als 50% der Quote des Grundstücks haben, können die Massnahmen trotzdem beschliessen, wenn sie die Kosten tragen und die nicht zustimmenden Stockwerkeigentümer für allfällige Beeinträchtigungen entschädigen.
Verwalter: Wird ein Verwalter eingesetzt, so kommen ihm die Aufgaben im Rahmen des Gesetzes oder des Stockwerkeigentümerreglements zu. Der Verwalter vertritt die Gemeinschaft gegen aussen.
3. Rechte und Pflichten der Stockwerkeigentümer
Mit der Stellung als Stockwerkeigentümer sind verschiedene Rechte und Pflichten verbunden. Diese können sich direkt aus dem Gesetz oder auch aus dem Stockwerkeigentümerreglement ergeben:
Kostenbeteiligung
Die Stockwerkeigentümer haben an die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums und an die Kosten der gemeinschaftlichen Verwaltung Beiträge nach Massgabe ihrer Wertquoten zu leisten. Zu solchen Lasten und Kosten gehören u.a.:
- Auslagen für den laufenden Unterhalt, Reparaturen und Erneuerungen der gemeinschaftlichen Teile des Grundstückes und Gebäudes;
- Kosten für die Verwaltungstätigkeit, also z.B. die Entschädigung des gewählten Verwalters;
- Abgaben und Steuern, die den Stockwerkeigentümern gemeinsam auferlegt werden;
- Zahlung von Zinsen und Amortisationen gegenüber Pfandgläubigern, die ein Pfandrecht am Grundstück haben oder denen gegenüber sich die Stockwerkeigentümer solidarisch verpflichtet haben.
Gemäss geltendem Gesetz haben die Stockwerkeigentümer untereinander ein sog. Retentionsrecht auf ausstehende Beitragsforderungen.
Verwaltung des Grundstücks
Die Stockwerkeigentümer verwalten das Grundstück im Rahmen der Stockwerkeigentümerversammlung gemeinsam und sorgen dafür, dass das Grundstück, sowie darauf stehenden Bauten und Anlagen instandgehalten werden.
Nachbarschaftsrechtliche Rechte und Pflichten
Das sog. Nachbarschaftsrecht sieht vor, dass die Bewohner Rücksicht auf ihre Nachbarn nehmen müssen. So gilt das Verbot der übermässigen Immissionen, was bedeutet, dass Lärm, Gestank, oder sonstige übermässig störende Verhaltensweisen der Nachbarn nicht geduldet werden müssen.
Auch die Stockwerkeigentümer, die das Haus selbst bewohnen, haben sich an das Verbot der übermässigen Immissionen zu halten.
Den Nachbarn, welche übermässig gestört sind, kommt ein Klagerecht zu.
Rechte und Pflichten gemäss Stockwerkeigentümerreglement
Das Stockwerkeigentümerreglement kann, wie oben gesehen, von der Stockwerkeigentümergemeinschaft beschlossen werden und weitere Rechte und Pflichten vorsehen.
Streitpunkte in der Praxis
Da die Stockwerkeigentümerschaft aus mehreren Parteien besteht, und hinter diesen Parteien regelmässig ganz individuelle Persönlichkeiten stecken, die sich nicht immer notwendigerweise einig sein müssen, kann das Leben in der Stockwerkeigentümergemeinschaft auch zu Streitigkeiten führen. Regelmässig handeln diese von den nachfolgenden Themen:
- Nutzung gemeinsamer Flächen (z. B. Abstellplätze, Gartenanteile)
- Beschluss und Kostenverteilung bei Sanierungen
- Lärmbelästigung (z.B. Umbauten, Musik)
4. Begründung von Stockwerkeigentum
Die Begründung des Stockwerkeigentums auf einem Grundstück erfordert immer eine öffentliche Beurkundung und einen Eintrag im Grundbuch. Die Schritte zur Begründung sind im Wesentlichen:
1. Begründungsakt (Teilungserklärung)
- Die Miteigentümer müssen sich in einem Vertrag über verschiedene Punkte einig werden: Dazu gehört, dass die Miteigentumsanteile (in Tausendstel) festgelegt und die einzelnen Sonderrechte definiert werden.
- Beispiel: Einheit A = 120/1000, Einheit B = 95/1000 usw.
2. Aufteilungsplan
- Dieser Plan – oft basierend auf den Bauplänen – zeigt die genaue Lage und Abgrenzung der Stockwerkeinheiten.
- Er ist verbindlich und massgeblich für die Aufteilung.
3. Stockwerkeigentümerreglement
- In der Praxis erstellen die meisten Gemeinschaften gleichzeitig ein Stockwerkeigentümerreglement.
- Wie oben gesehen kann dieses diverse Rechte und Pflichten festhalten.
4. Grundbucheintrag
- Erst mit dem Eintrag in das Grundbuch entsteht das Stockwerkeigentum rechtlich.
- Ohne diesen Schritt besteht nur gewöhnliches Miteigentum.
Hinweis: Eine Liegenschaft mit bestehender Baute kann zu einem beliebigen Zeitpunkt in Stockwerkeigentum aufgeteilt werden, z. B. wenn ein Mehrfamilienhaus verkauft werden soll. Genauso kann aber auch an einem Grundstück, auf welchem das Bauwerk gar noch nicht fertiggestellt wurde, Stockwerkeigentum begründet werden.
5. Kauf oder Verkauf von Stockwerkeigentum
Der Kauf resp. Verkauf erfolgt gemäss den Regeln des Grundstückkaufs. Das bedeutet, dass der schriftliche Kaufvertrag notariell zu beurkunden ist und das Eigentum erst mit Eintrag ins Grundbuch übergeht.
Folgende Punkte sind beim Kauf von Stockwerkeigentum im Auge zu behalten:
- Stockwerkeigentümerreglement einsehen – dieses regelt z.B. die Verwaltung, Aufteilung und Bezeichnung von Parkplätzen, etc.
- Protokolle der letzten Versammlungen lesen – um geplante Sanierungen und Streitpunkte zu kennen.
- Erneuerungsfonds prüfen – ein zu kleiner Fonds kann bald zu hohen Sonderzahlungen führen.
- Baulicher Zustand – auch gemeinschaftliche Teile wie das Dach können kostenintensiv werden.
- Nebenkosten – nicht nur die Hypothek, sondern auch die Kosten für Verwaltung, Unterhalt und Rücklagen sind einkalkulieren.
Beim Verkauf sind insbesondere folgende Punkte wichtig:
- Offene Beitragsforderungen der Gemeinschaft sollten vorab geklärt werden.
- Die Verkäuferschaft sollte der Käuferschaft ein allfälliges Stockwerkeigentümerreglement zur Einsicht zur Verfügung stellen und dafür besorgt sein, dass dieses von der Käuferschaft übernommen wird.
Fazit
Stockwerkeigentum verbindet individuelles Wohneigentum mit gemeinschaftlicher Verantwortung. Es gilt den gesetzlichen Pflichten nachzukommen und die Stockwerkeigentümergemeinschaft klar zu regeln, damit potenzielle Konflikte vermieden werden können. Beim Kauf von Stockwerkeigentum gilt es ein besonderes Augenmerk auf die mit der Mitgliedschaft in der Stockwerkeigentümergemeinschaft verbundenen Verpflichtungen zu legen.